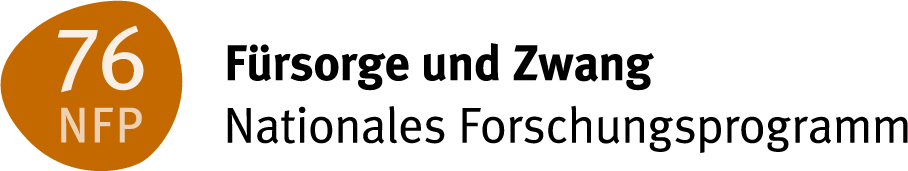Fremdplatzierungen in der Schweiz: Erfahrungsberichte von Opfern und Erinnerungsarbeit
Die offizielle Anerkennung historischen Unrechts, welches im Kontext von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen begangen wurde, hat eine öffentliche Debatte, darüber ausgelöst, wie das Leid der Betroffenen anerkannt werden sollte. Die Opfer dieser Massnahmen selbst haben durch ihre Forderung nach Anerkennung und Entschädigung eine Schlüsselrolle in dieser Debatte gespielt, was diesen Abschnitt der jüngsten Schweizer Geschichte stärker ins Bewusstsein gerückt hat.
Projektbeschrieb (abgeschlossenes Forschungsprojekt)
Die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in der Schweiz haben persönliche Traumata bei vielen Opfern ausgelöst. Sie waren auch der Ausgangspunkt für einen gemeinschaftlichen Prozess der "Erinnungsarbeit", in Form von kritischen Debatten über grundlegende politische Themen wie zum Beispiel der Beziehung zwischen Bürger/in/n und Staat, soziale Ungerechtigkeit, und der Entschädigung von vergangenem Unrecht. Die Studie analysiert die zentrale Rolle, die die Opfer dieser Massnahmen in diesem Prozess gespielt haben. Wir haben untersucht, wie es ihnen gelungen ist, sich Gehör zu verschaffen und haben erforscht, welche Stimmen oder welche Belange bisher untergegangen sind oder in den Medien und politischen Debatten wenig Beachtung erhalten haben (2000–2017). Im ersten Schritt sind wir diesen Fragen im nationalen Kontext nachgegangen. Grundlage bilden Interviews mit Akteuren, die eine Schlüsselrolle in diesem Prozess gespielt haben (Repräsentanten von Organisationen, die Opfer repräsentieren, Politikern etc.). In einem zweiten Schritt haben wir Vergleiche mit ähnlichen Erfahrungen von "Erinnerungsarbeit" in anderen nationalen Kontexten gezogen: Großbritannien, Kanada und Australien.
Resultate
Die Zusammenfassung der Ergebnisse zu diesem Projekt finden sich hier:
Originaltitel
Victim narratives, ‘memory work’ and the remaking of Swiss national identity: a discourse analysis of the memorialisation of compulsory social measures and placements in Switzerland in comparative perspective.